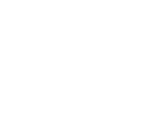START
Der Ethnophonograph behandelt das Denken, Wahrnehmen und Darstellen der Welt im Medium des Klangs. Die Ethnophonographie ist eine Methode zur hörsinnlichen Forschung. Sie schafft eine auditive Kartierung der Welt, beschreibt den sozio-akustischen Raum in Form der polyphonen Erzählung und ist eine spezifische Form der dichten ethnographischen Beschreibung. Grundlage ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer praktischen Radiofeature-Arbeit.
mehr:

START
Der Ethnophonograph behandelt das Denken, Wahrnehmen und Darstellen der Welt im Medium des Klangs. Die Ethnophonographie ist eine Methode zur hörsinnlichen Forschung. Sie schafft eine auditive Kartierung der Welt, beschreibt den sozio-akustischen Raum in Form der polyphonen Erzählung und ist eine spezifische Form der dichten ethnographischen Beschreibung. Grundlage ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer praktischen Radiofeature-Arbeit.
mehr:

Stimmen Uni Bremen
Am 19.12.2024 10:15 Uhr Keksdose
Von Javier Gago Holzscheiter
Im Radio hören wir Stimmen, sie klingen schön, sie klingen wie aus dem "Bilderbuch". O-Töne von Akteur:innen aus Wirtschaft und Politik oft auch; sie klingen immer "inszeniert". Menschen der kulturellen Öffentlichkeit sind geschult für das schöne Sprechen: Sie betonen, sie spielen mit der Rhetorik, heben dies oder jenes hervor. Wussten Sie, dass John Wayne, der toughe Cowboy als das Selbstverständnis der USA in den 50ern, eine Piepsstimme hatte (wurde auch im Englischen synchronisiert), dass in den USA die mickrige Stimme das Adlers verändert wird, damit er klingt, wie er als der Symbol der Macht eben klingen soll: erhaben?
Schauspieler:innen sorgen dafür, dass fremdsprachige O-Töne immer "authentisch" klingen. Aber wer spricht denn dann eigentlich? Und überhaupt: Was ist die Stimme? Was mögen wir an Stimmen? Schöne Stimme, heisere Stimme, versoffene Stimme, Engelsstimme, KI generierte Stimmen. Fragen über Fragen: Da stimmt doch was nicht... Sprechen wir darüber!

allgemein
Von Javier Gago Holzscheiter
Erzählungen – also ein Anderswo, Anderswie und Anderswer – zeigen sich im diskursiven Raum, im Text. Immer häufiger ist der diskursive Raum ein rein ästhetischer, jenseits einer Verortung seiner selbst in einem "da draußen". Der Raum – als dieser materielle – ist oft zurückgeworfen auf lediglich seine Krisenhaftigkeit, hier kann ich nicht sein. Verlässt der Mensch diesen Raum verliert der Raum seine Relevanz in der Alltäglichkeit. Mit den Worten: "Ich bin hier" oder "Hier bin ich" verorten wir uns, räumlich wie zeitlich. Stimmen und Klänge als die lebendigen Repräsentanten eines Ortes verweben uns in einen solch klanglich gefassten sozialen, wie materiellen Raum des Alltäglichen. Ethnophonographie ist dabei auch die Einladung, Raum – das "da draußen" jenseits des Diskurses, jenseits des Digitalen – zu denken, zu erfahren und zu erleben.
15.4.2022
Ein Nachruf
Von Javier Gago Holzscheiter
Ich kann mich nicht genau erinnern. Es muss im Januar oder Februar 2011 gewesen sein. Natürlich kannte ich die Arbeiten von Letizia Battaglia sehr viel länger, schließlich lag mein Studium der Italianistik an der Universität Bremen schon einige Jahre zurück. Und als Studiengang der besonderen Art, der nicht bloß Landeskunde anbot, sondern stattdessen und darüberhinaus die Landeswissenschaften als dritte Säule neben der Sprach- und Literaturwissenschaft zu etablieren suchte, konnte ich sie nicht nicht kennen. Schließlich ist sie die Fotografin Italiens gewesen, die Fotografin mit der kleinen Leica, die nicht bloß bei Italienist:innen bekannt war, sondern immer wieder auch in der internationalen Presse aufblitzte.
Gesehen habe ich sie damals das erste Mal im Frühjahr 2011. Es war eine besondere Begegnung. Die Deutsche-Italienische Gesellschaft hatte in Kooperation mit dem Übersee-Museum einen Vortrag organisiert. Das Thema war natürlich die Mafia. In der Hochschule für Künste verschob sich das Interesse des interessierten jungen Publikums hin zur Kunst, zur Photographie. Sie saß im Seminar und strahlte eine Kraft und Energie aus, wie es nur wenigen Menschen gelingt; die Studierenden waren ganz in ihren Bann gezogen. Wie kann es auch anders sein?
Das letzte Mal habe ich sie gesehen auf ihrer Terrasse in Palermo. Das ist nun schon viel zu lange her. Im Rahmen eines Projekts, welches zum Fokus sizilianische Frauen hatte und leider nie einen Abschluss fand, war ich mit ihr verabredet, um mit ihr über ihr Leben, ihre palermitanische Biografie zu sprechen. Nun, es kam anders, denn zuvor sprach ich mit ihrer Tochter Shobar. Es war ein langes Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch Letizia, trotzdem sie eine Etage tiefer saß, an ihm teilnahm, es war ein sehr bewegender Einblick in die Welt des Patriarchats, auch jenseits Siziliens.
Befasste ich mich mit dem Klang der Stadt, war es Letizia, die ihre Kamera nutzte, um zu zeigen, was sie zeigen wollte, die Missstände ihrer Stadt. Mit ihrer Kamera fokussierte sie Morde, im Gespräch aber beschwor sie das Potenzial ihrer Stadt: Es könnte die schönste sein, die schönste Stadt im Mediterran, sagte sie und versammelte die Intellektuellen der Stadt und über die Grenzen hinaus um sich, das zu beweisen. Sie blickte in die Zukunft und ich bin mir sicher, dass sie die Manifesta 12 Kunstbiennale 2018 oder die steten Neuerungen der Stadt unter Führung von Leoluca Orlando mit Stolz erfüllten.
An einer für mich sehr wichtigen Gabelung trafen wir uns. Sie kam 2011 nach Bremen. Ich folgte ihr nach Palermo, wo ich zwar eh hinwollte, aber die Sympathie, die wir füreinander verspürten, gab meinem Aufenthalt eine andere, eine besondere Note, Unterstützung von Letizia Battaglia, wow! „Du kannst erstmal in meiner Altstadt-Wohnung wohnen“. Sie freute sich, dass ein Bremer nach Palermo kam, um dort zu forschen und vielleicht eine andere Geschichte zu erzählen als die, die sie in ihrem Leben mit ihren Fotos so oft erzählt hat und hat erzählen müssen.
Die vielleicht eindrücklichste Anekdote, die ihre Perspektive auf die so widersprüchliche Welt, in der wir leben zum Ausdruck bringt, ereignet sich in einem Lokal mit authentischer palermitanischer Küche namens Rosa e Nero. Heute eine etablierte Adresse unweit der Via Maqueda im Herzen von Palermo. Damals eine von einem jungen Paar aus dem Nichts, mit allerlei Gebrauchtem gezauberte Baracke, in dem sie kochte und er servierte. Als sich Letizia eine Zigarette anzündet, ruft der junge Gastronom: „Signora, das Rauchen ist hier nicht erlaubt, das ist illegal!“ Sie aber erwidert: „Junger Mann! Alles hier, das ganze Lokal ist illegal“!
Am Mittwoch, den 14. April ist sie im Alter von 87 Jahren in ihrer Stadt Palermo verstorben.
15.4.2022
Ein Nachruf
Von Javier Gago Holzscheiter
Ich kann mich nicht genau erinnern. Es muss im Januar oder Februar 2011 gewesen sein. Natürlich kannte ich die Arbeiten von Letizia Battaglia sehr viel länger, schließlich lag mein Studium der Italianistik an der Universität Bremen schon einige Jahre zurück. Und als Studiengang der besonderen Art, der nicht bloß Landeskunde anbot, sondern stattdessen und darüberhinaus die Landeswissenschaften als dritte Säule neben der Sprach- und Literaturwissenschaft zu etablieren suchte, konnte ich sie nicht nicht kennen. Schließlich ist sie die Fotografin Italiens gewesen, die Fotografin mit der kleinen Leica, die nicht bloß bei Italienist:innen bekannt war, sondern immer wieder auch in der internationalen Presse aufblitzte.
Gesehen habe ich sie damals das erste Mal im Frühjahr 2011. Es war eine besondere Begegnung. Die Deutsche-Italienische Gesellschaft hatte in Kooperation mit dem Übersee-Museum einen Vortrag organisiert. Das Thema war natürlich die Mafia. In der Hochschule für Künste verschob sich das Interesse des interessierten jungen Publikums hin zur Kunst, zur Photographie. Sie saß im Seminar und strahlte eine Kraft und Energie aus, wie es nur wenigen Menschen gelingt; die Studierenden waren ganz in ihren Bann gezogen. Wie kann es auch anders sein?
Das letzte Mal habe ich sie gesehen auf ihrer Terrasse in Palermo. Das ist nun schon viel zu lange her. Im Rahmen eines Projekts, welches zum Fokus sizilianische Frauen hatte und leider nie einen Abschluss fand, war ich mit ihr verabredet, um mit ihr über ihr Leben, ihre palermitanische Biografie zu sprechen. Nun, es kam anders, denn zuvor sprach ich mit ihrer Tochter Shobar. Es war ein langes Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch Letizia, trotzdem sie eine Etage tiefer saß, an ihm teilnahm, es war ein sehr bewegender Einblick in die Welt des Patriarchats, auch jenseits Siziliens.
Befasste ich mich mit dem Klang der Stadt, war es Letizia, die ihre Kamera nutzte, um zu zeigen, was sie zeigen wollte, die Missstände ihrer Stadt. Mit ihrer Kamera fokussierte sie Morde, im Gespräch aber beschwor sie das Potenzial ihrer Stadt: Es könnte die schönste sein, die schönste Stadt im Mediterran, sagte sie und versammelte die Intellektuellen der Stadt und über die Grenzen hinaus um sich, das zu beweisen. Sie blickte in die Zukunft und ich bin mir sicher, dass sie die Manifesta 12 Kunstbiennale 2018 oder die steten Neuerungen der Stadt unter Führung von Leoluca Orlando mit Stolz erfüllten.
An einer für mich sehr wichtigen Gabelung trafen wir uns. Sie kam 2011 nach Bremen. Ich folgte ihr nach Palermo, wo ich zwar eh hinwollte, aber die Sympathie, die wir füreinander verspürten, gab meinem Aufenthalt eine andere, eine besondere Note, Unterstützung von Letizia Battaglia, wow! „Du kannst erstmal in meiner Altstadt-Wohnung wohnen“. Sie freute sich, dass ein Bremer nach Palermo kam, um dort zu forschen und vielleicht eine andere Geschichte zu erzählen als die, die sie in ihrem Leben mit ihren Fotos so oft erzählt hat und hat erzählen müssen.
Die vielleicht eindrücklichste Anekdote, die ihre Perspektive auf die so widersprüchliche Welt, in der wir leben zum Ausdruck bringt, ereignet sich in einem Lokal mit authentischer palermitanischer Küche namens Rosa e Nero. Heute eine etablierte Adresse unweit der Via Maqueda im Herzen von Palermo. Damals eine von einem jungen Paar aus dem Nichts, mit allerlei Gebrauchtem gezauberte Baracke, in dem sie kochte und er servierte. Als sich Letizia eine Zigarette anzündet, ruft der junge Gastronom: „Signora, das Rauchen ist hier nicht erlaubt, das ist illegal!“ Sie aber erwidert: „Junger Mann! Alles hier, das ganze Lokal ist illegal“!
Am Mittwoch, den 14. April 2022, ist sie im Alter von 87 Jahren in ihrer Stadt Palermo verstorben.

Murray Schafer: Sound und Seismographie
Nachruf auf den Klangforscher, Komponisten und Autoren im Rahmen der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie zum Anthropozän

Für die Ethnophonographie ist Grundlage das Radio, der Radiobeitrag, das Radiofeature, das Radio-Interview, die Reportage, Radio halt! Und Sound!
Feature|Sound|Theorie

Aktuell
21. Januar 2022
Von Javier Gago Holzscheiter
Erzählungen – also ein Anderswo, Anderswie und Anderswer – zeigen sich im diskursiven Raum, im Text. Immer häufiger ist der diskursive Raum ein rein ästhetischer, jenseits einer Verortung seiner selbst in einem "da draußen". Der Raum – als dieser materielle – ist oft zurückgeworfen auf lediglich seine Krisenhaftigkeit, hier kann ich nicht sein. Verlässt der Mensch diesen Raum verliert der Raum seine Relevanz in der Alltäglichkeit. Mit den Worten: "Ich bin hier" oder "Hier bin ich" verorten wir uns, räumlich wie zeitlich. Stimmen und Klänge als die lebendigen Repräsentanten eines Ortes verweben uns in einen solch klanglich gefassten sozialen, wie materiellen Raum des Alltäglichen. Ethnophonographie ist dabei auch die Einladung, Raum – das "da draußen" jenseits des Diskurses, jenseits des Digitalen – zu denken, zu erfahren und zu erleben.
15.4.2022
Ein Nachruf
Von Javier Gago Holzscheiter
Ich kann mich nicht genau erinnern. Es muss im Januar oder Februar 2011 gewesen sein. Natürlich kannte ich die Arbeiten von Letizia Battaglia sehr viel länger, schließlich lag mein Studium der Italianistik an der Universität Bremen schon einige Jahre zurück. Und als Studiengang der besonderen Art, der nicht bloß Landeskunde anbot, sondern stattdessen und darüberhinaus die Landeswissenschaften als dritte Säule neben der Sprach- und Literaturwissenschaft zu etablieren suchte, konnte ich sie nicht nicht kennen. Schließlich ist sie die Fotografin Italiens gewesen, die Fotografin mit der kleinen Leica, die nicht bloß bei Italienist:innen bekannt war, sondern immer wieder auch in der internationalen Presse aufblitzte.
Gesehen habe ich sie damals das erste Mal im Frühjahr 2011. Es war eine besondere Begegnung. Die Deutsche-Italienische Gesellschaft hatte in Kooperation mit dem Übersee-Museum einen Vortrag organisiert. Das Thema war natürlich die Mafia. In der Hochschule für Künste verschob sich das Interesse des interessierten jungen Publikums hin zur Kunst, zur Photographie. Sie saß im Seminar und strahlte eine Kraft und Energie aus, wie es nur wenigen Menschen gelingt; die Studierenden waren ganz in ihren Bann gezogen. Wie kann es auch anders sein?
Das letzte Mal habe ich sie gesehen auf ihrer Terrasse in Palermo. Das ist nun schon viel zu lange her. Im Rahmen eines Projekts, welches zum Fokus sizilianische Frauen hatte und leider nie einen Abschluss fand, war ich mit ihr verabredet, um mit ihr über ihr Leben, ihre palermitanische Biografie zu sprechen. Nun, es kam anders, denn zuvor sprach ich mit ihrer Tochter Shobar. Es war ein langes Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch Letizia, trotzdem sie eine Etage tiefer saß, an ihm teilnahm, es war ein sehr bewegender Einblick in die Welt des Patriarchats, auch jenseits Siziliens.
Befasste ich mich mit dem Klang der Stadt, war es Letizia, die ihre Kamera nutzte, um zu zeigen, was sie zeigen wollte, die Missstände ihrer Stadt. Mit ihrer Kamera fokussierte sie Morde, im Gespräch aber beschwor sie das Potenzial ihrer Stadt: Es könnte die schönste sein, die schönste Stadt im Mediterran, sagte sie und versammelte die Intellektuellen der Stadt und über die Grenzen hinaus um sich, das zu beweisen. Sie blickte in die Zukunft und ich bin mir sicher, dass sie die Manifesta 12 Kunstbiennale 2018 oder die steten Neuerungen der Stadt unter Führung von Leoluca Orlando mit Stolz erfüllten.
An einer für mich sehr wichtigen Gabelung trafen wir uns. Sie kam 2011 nach Bremen. Ich folgte ihr nach Palermo, wo ich zwar eh hinwollte, aber die Sympathie, die wir füreinander verspürten, gab meinem Aufenthalt eine andere, eine besondere Note, Unterstützung von Letizia Battaglia, wow! „Du kannst erstmal in meiner Altstadt-Wohnung wohnen“. Sie freute sich, dass ein Bremer nach Palermo kam, um dort zu forschen und vielleicht eine andere Geschichte zu erzählen als die, die sie in ihrem Leben mit ihren Fotos so oft erzählt hat und hat erzählen müssen.
Die vielleicht eindrücklichste Anekdote, die ihre Perspektive auf die so widersprüchliche Welt, in der wir leben zum Ausdruck bringt, ereignet sich in einem Lokal mit authentischer palermitanischer Küche namens Rosa e Nero. Heute eine etablierte Adresse unweit der Via Maqueda im Herzen von Palermo. Damals eine von einem jungen Paar aus dem Nichts, mit allerlei Gebrauchtem gezauberte Baracke, in dem sie kochte und er servierte. Als sich Letizia eine Zigarette anzündet, ruft der junge Gastronom: „Signora, das Rauchen ist hier nicht erlaubt, das ist illegal!“ Sie aber erwidert: „Junger Mann! Alles hier, das ganze Lokal ist illegal“!
Am Mittwoch, den 14. April ist sie im Alter von 87 Jahren in ihrer Stadt Palermo verstorben.
15.4.2022
Ein Nachruf
Von Javier Gago Holzscheiter
Ich kann mich nicht genau erinnern. Es muss im Januar oder Februar 2011 gewesen sein. Natürlich kannte ich die Arbeiten von Letizia Battaglia sehr viel länger, schließlich lag mein Studium der Italianistik an der Universität Bremen schon einige Jahre zurück. Und als Studiengang der besonderen Art, der nicht bloß Landeskunde anbot, sondern stattdessen und darüberhinaus die Landeswissenschaften als dritte Säule neben der Sprach- und Literaturwissenschaft zu etablieren suchte, konnte ich sie nicht nicht kennen. Schließlich ist sie die Fotografin Italiens gewesen, die Fotografin mit der kleinen Leica, die nicht bloß bei Italienist:innen bekannt war, sondern immer wieder auch in der internationalen Presse aufblitzte.
Gesehen habe ich sie damals das erste Mal im Frühjahr 2011. Es war eine besondere Begegnung. Die Deutsche-Italienische Gesellschaft hatte in Kooperation mit dem Übersee-Museum einen Vortrag organisiert. Das Thema war natürlich die Mafia. In der Hochschule für Künste verschob sich das Interesse des interessierten jungen Publikums hin zur Kunst, zur Photographie. Sie saß im Seminar und strahlte eine Kraft und Energie aus, wie es nur wenigen Menschen gelingt; die Studierenden waren ganz in ihren Bann gezogen. Wie kann es auch anders sein?
Das letzte Mal habe ich sie gesehen auf ihrer Terrasse in Palermo. Das ist nun schon viel zu lange her. Im Rahmen eines Projekts, welches zum Fokus sizilianische Frauen hatte und leider nie einen Abschluss fand, war ich mit ihr verabredet, um mit ihr über ihr Leben, ihre palermitanische Biografie zu sprechen. Nun, es kam anders, denn zuvor sprach ich mit ihrer Tochter Shobar. Es war ein langes Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch Letizia, trotzdem sie eine Etage tiefer saß, an ihm teilnahm, es war ein sehr bewegender Einblick in die Welt des Patriarchats, auch jenseits Siziliens.
Befasste ich mich mit dem Klang der Stadt, war es Letizia, die ihre Kamera nutzte, um zu zeigen, was sie zeigen wollte, die Missstände ihrer Stadt. Mit ihrer Kamera fokussierte sie Morde, im Gespräch aber beschwor sie das Potenzial ihrer Stadt: Es könnte die schönste sein, die schönste Stadt im Mediterran, sagte sie und versammelte die Intellektuellen der Stadt und über die Grenzen hinaus um sich, das zu beweisen. Sie blickte in die Zukunft und ich bin mir sicher, dass sie die Manifesta 12 Kunstbiennale 2018 oder die steten Neuerungen der Stadt unter Führung von Leoluca Orlando mit Stolz erfüllten.
An einer für mich sehr wichtigen Gabelung trafen wir uns. Sie kam 2011 nach Bremen. Ich folgte ihr nach Palermo, wo ich zwar eh hinwollte, aber die Sympathie, die wir füreinander verspürten, gab meinem Aufenthalt eine andere, eine besondere Note, Unterstützung von Letizia Battaglia, wow! „Du kannst erstmal in meiner Altstadt-Wohnung wohnen“. Sie freute sich, dass ein Bremer nach Palermo kam, um dort zu forschen und vielleicht eine andere Geschichte zu erzählen als die, die sie in ihrem Leben mit ihren Fotos so oft erzählt hat und hat erzählen müssen.
Die vielleicht eindrücklichste Anekdote, die ihre Perspektive auf die so widersprüchliche Welt, in der wir leben zum Ausdruck bringt, ereignet sich in einem Lokal mit authentischer palermitanischer Küche namens Rosa e Nero. Heute eine etablierte Adresse unweit der Via Maqueda im Herzen von Palermo. Damals eine von einem jungen Paar aus dem Nichts, mit allerlei Gebrauchtem gezauberte Baracke, in dem sie kochte und er servierte. Als sich Letizia eine Zigarette anzündet, ruft der junge Gastronom: „Signora, das Rauchen ist hier nicht erlaubt, das ist illegal!“ Sie aber erwidert: „Junger Mann! Alles hier, das ganze Lokal ist illegal“!
Am Mittwoch, den 14. April ist sie im Alter von 87 Jahren in ihrer Stadt Palermo verstorben.

Murray Schafer: Sound und Seismographie
Nachruf auf den Klangforscher, Komponisten und Autoren im Rahmen der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie zum Anthropozän

Für die Ethnophonographie ist Grundlage das Radio, der Radiobeitrag, das Radiofeature, das Radio-Interview, die Reportage, Radio halt! Und Sound!
Feature|Sound|Theorie

Zum Nachhören vom 17.10.2021
Die Inflation der angenehmen Stimmen
Von Christoph Spittler
Sonor, gutgelaunt und wohl artikuliert raunt es im Fernsehen, Kino, Radio und aus Supermarktlautsprechern. Wir sind umzingelt von schmeichelnden Werbestimmen. In Hollywoodfilmen spricht noch der letzte Obdachlose mit sattem Timbre und perfekter Betonung.

Zum Nachhören vom 17.10.2021
Die Inflation der angenehmen Stimmen
Von Christoph Spittler
Sonor, gutgelaunt und wohl artikuliert raunt es im Fernsehen, Kino, Radio und aus Supermarktlautsprechern. Wir sind umzingelt von schmeichelnden Werbestimmen. In Hollywoodfilmen spricht noch der letzte Obdachlose mit sattem Timbre und perfekter Betonung.

Zum Nachhören vom 12.08.2022
Alltagsrassismus in der Populärkultur
Von Manuel Gogos
Rassismus war im Leben des Autors immer präsent. Er steckte in Dingen, die er liebte: Im Schokokuss, den er sich morgens vor der Schule aus der Bäckerei holte. In Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf im Taka-Tuka-Land oder Jim Knopf, in der bezaubernden Fassung der Augsburger Puppenkiste.

Zum Nachhören vom 12.08.2022
Alltagsrassismus in der Populärkultur
Von Manuel Gogos
Rassismus war im Leben des Autors immer präsent. Er steckte in Dingen, die er liebte: Im Schokokuss, den er sich morgens vor der Schule aus der Bäckerei holte. In Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf im Taka-Tuka-Land oder Jim Knopf, in der bezaubernden Fassung der Augsburger Puppenkiste.

Musikcafés in Japan
Von Andreas Hartmann

Zum Nachhören
Eine Ortserkundung an der Autobahnraststätte
Von Annette Scheld

Zum Nachhören vom 15.9.2020
Humboldt Forum, Shared Heritage und der Umgang mit dem Anderen
Von Lorenz Rollhäuser
Die Beniner Bronzen gehören zu den 20.000 Exponaten aus der ganzen Welt, die im Humboldt Forum auf über 30.000 Quadratmetern ausgestellt werden. Die Bronzefiguren sind nicht nur in den Berliner Sammlungen eine Attraktion, sondern werden auch in mehreren deutschen ethnologischen Museen gezeigt. Dass sie 1897 von britischen Truppen aus dem heutigen Nigeria geraubt wurden, war lange kein Thema. Doch was die Museen als „Shared Heritage“ bezeichnen, empfinden Kritiker heute als „Raubkunst“. Wem gehören die Bronzen wirklich? Kann „Shared Heritage“ funktionieren? Und wie viel koloniale Arroganz steckt in der Ausstellungsplanung? Der Autor reist in das Mutterland der Bronzen und spricht mit Kritikern und Kuratoren.

Zum Nachhören
Eine Ortserkundung an der Autobahnraststätte
Von Annette Scheld
Unscheinbar liegen sie an den Autobahnen, oft in idyllischer Landschaft, wie Flusshäfen. Wer dort aussteigt, den erwartet ein effizient durchverwalteter Nicht-Ort mit Toilette und Bockwurst. Und anderen Verkehrsteilnehmerinnen aller sozialen Klassen, die vor allem weiterwollen. Was ist, wenn man doch etwas länger bleibt? Ein Feature über Transitorte, Unterwegssein und die Möglichkeit des Abenteuers unter einer schäbigen Oberfläche. Und über ein weißes Reh am Autobahnrand.